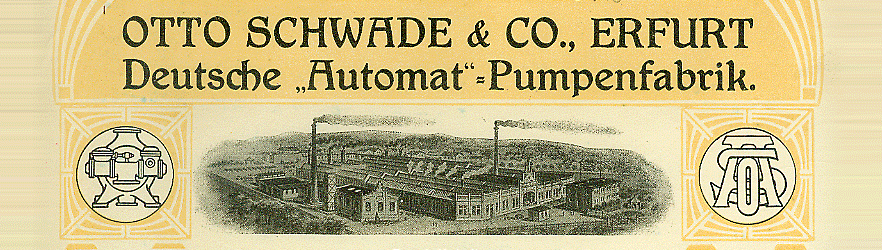Weimarer Porzellan kommt aus Blankenhain

Schon im 18. Jahrhundert hatte man erkannt, dass die Gesteinsschichten der Blankenhainer Umgebung für die Produktion von Porzellan in Frage kommen. Daraufhin wagte Christian Andreas Wilhelm Speck, sich mit einer Porzellanfabrikation selbstständig zu machen. Er erhielt die Konzession zur Porzellanproduktion am 1. Juli 1790. Die Urkunde war in Wien ausgestellt worden. Zur Einrichtung seiner Fabrik hatte Speck das Schießhaus in Blankenhain erworben und umgebaut.
Tassen und Pfeifenköpfe
Seine ersten Erzeugnisse waren Tassen, kleine Figuren und Pfeifenköpfe. 1797 stellte Speck erstmals auf der Leipziger Messe aus. Damals benutzte er als Fabrikmarke das blaue "S" (für Speck) unter Glasur. Als Blankenhain 1815 in die großherzoglich-sächsische Herrschaft überging, beschäftigte Speck 155 Personen, die 11.000 Reichstaler verdienten. Das "Umtriebskapital" der Fabrik schätzte er auf 20.000 Reichstaler. Doch im Sommer 1817 ereilte die Fabrik ein verheerender Brand, beinahe die ganze Anlage fiel in Schutt und Asche. Aber sie wurde erneut aufgebaut. Schon 1821 exportierte sie ihr Porzellan wieder nach Preußen.
Des großen Goethes Lob
Übrigens - auch Johann Wolfgang von Goethe kannte damals das Porzellan aus Blankenhain, von ihm stammen die Zeilen: "...das Porzellan ist gut, besser als man es ganz in der Nähe zu machen vermag und nicht teuerer." Selbst der Weimarer Hof kaufte im Porzellanwerk ein, schließlich gehörte es ja nun zum Herrschaftsgebiet.
Als Speck 1830 starb, war die Fabrik auf Gustav Vogt übergegangen. 1830 sollen nur noch 25 Arbeiter und Lehrlinge im Werk gearbeitet haben. Dazu gehörten mehrere Dreher, Bunt- und Blaumaler, je ein Tier-, Landschafts-, Figuren-, Jagd-, Kunst-, Prospekten- und Porträtmaler, außerdem ein "akademischer" Maler, ein Dekorateur und ein Former. Vogt hatte gute künstlerische Fachkräfte herangezogen, was eine Steigerung der Qualität der Blankenhainer Ware bewirkte. Doch schon 1836 verkaufte Vogt die Fabrik - die Eigentümer wechselten. 1856 kam Victor Fasolt aus der bayerischen Stadt Selb. Für die Fabrik begann jetzt eine Zeit des Aufschwungs. Fasolt verband sich mit Ferdinand Eichel zur Firma Fasolt & Eichel. Die neuen Inhaber erweiterten die Fabrikanlagen. Vor allem stellten sie die Öfen auf Steinkohlefeuerung um, damit waren sie die Ersten in Thüringen. Die bisher bescheidene Produktion konnten sie vervielfachen.
Eine resolute Frau
Nach dem Tod der beiden Inhaber übernahm Elisabeth Fasolt, die hinterbliebene Witwe, das Ruder in der Fabrik. Sie stammte aus einer in Porzellankreisen bekannten Familie, ihr Geburtsname war Hutschenreuther. Ihr wurde bescheinigt, dass sie "begabt mit einer außergewöhnlichen Befähigung zur Leitung" war. Sie führte und erweiterte das Unternehmen resolut - "mit energischer Hand und zielbewusstem Blick". 1879 übergab sie es an ihre beiden Söhne. Auch sie entwickelten und vergrößerten das Werk und die Produktion in den folgenden 20 Jahren weiter. Schon 1891 verfügten sie über Wasser- und Dampfkraft und beschäftigten 250 Arbeitskräfte. Die Fasolt-Brüder schufen eine neue Fabrikmarke, die sich an das sächsische Rautenschild anlehnte und die Inschrift "Weimar" erhielt. Doch 1905 erkrankte erst Karl Fasolt, 1906 starb sein Bruder. Die Fabrik musste 1909 veräußert werden. Seit 1918 gehörte das Werk zur Firma C. & E. Carstens. Nun wurde der Export wieder kräftig angekurbelt, zugleich der Name "Weimar-Porzellan" etabliert. Der Krieg brachte erneut Einschnitte, auch in der Erzeugnispalette. Und danach? 1948 wurde der größte Blankenhainer Betrieb enteignet. Blieb aber als "VEB Weimar-Porzellan" bestehen. Nach der Wende ging es auf und ab, die Eigentümer wechselten mehrmals. Heute gehört Weimar-Porzellan zu einem anderen thüringischen Porzellanhersteller. (gekürzt)